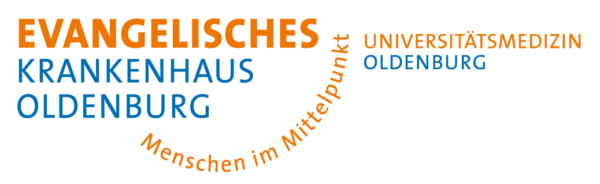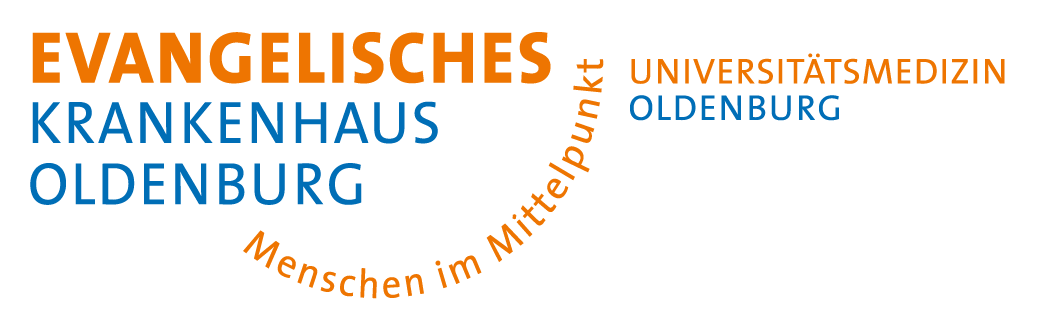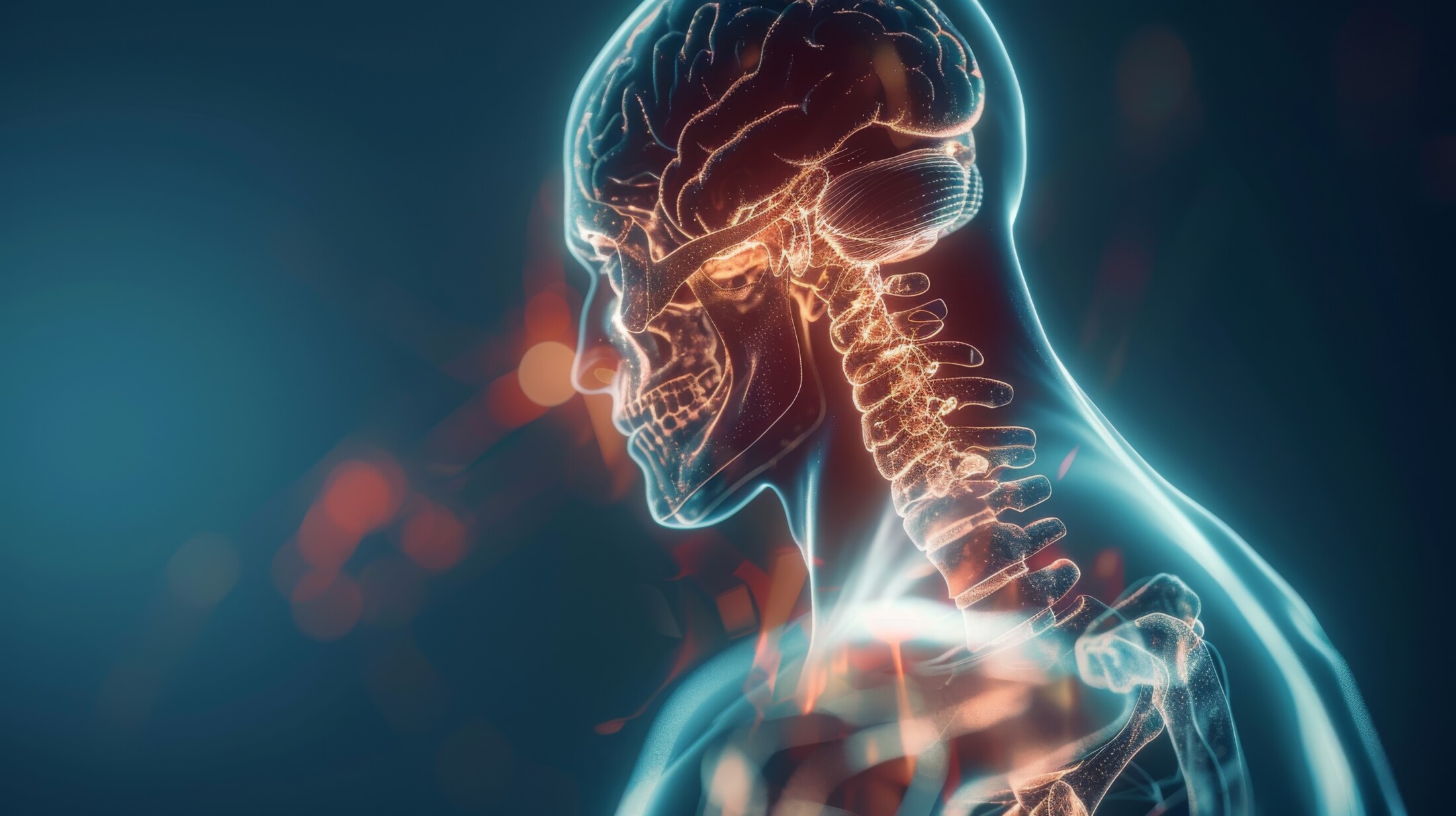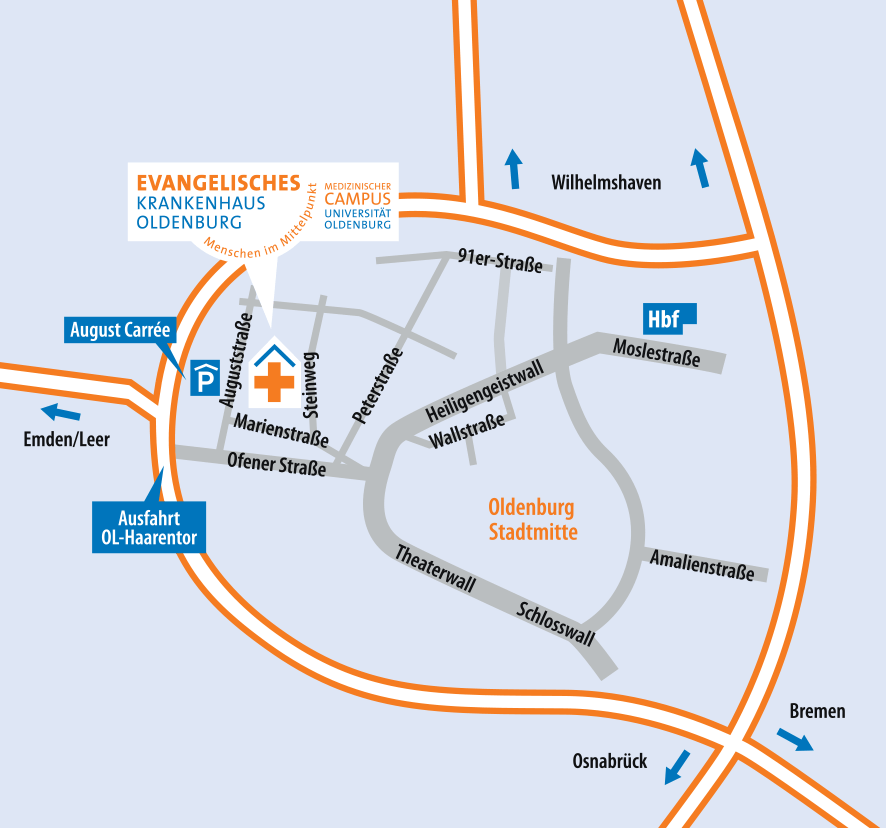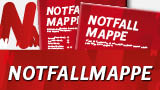Startseite - Forschung und Lehre - Neurochirurgie
Neurochirurgie
Die Universitätsklinik für Neurochirurgie am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg vereint die Abteilungen Kopf- und Nervenchirurgie mit spezieller Neurochirurgischer Intensivmedizin sowie die Wirbelsäulenchirurgie.
Die neurochirurgische Forschung an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg ist dabei eng mit der klinischen Arbeit verzahnt und umfasst sowohl klinische Forschungsprojekte als auch experimentelle Arbeiten mit hohem translationalen Anspruch.
Forschung
Mitarbeiter*Innen
Direktor:
Prof. Dr. med. Johannes Woitzik (Johannes.woitzik@evangelischeskrankenhaus.de; 0441 236 422)
Sekretariat:
Evelyn Buchholz (evelyn.buchholz@evangelischeskrankenhaus.de; 0441 236 9350)
Laborleitung:
Dr. Patrick Dömer (patrick.doemer@uni-oldenburg.de; 0441 798 3288)
Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Dr. Simeon Helgers (Simeon.helgers@uni-oldenburg.de; 0441 798 3288)
Annika Köhne (Annika.koehne@uni-oldenburg.de; 0441 798 3685)
Bettina Kewitz (Bettina.kewitz@uni-oldenburg.de; 0441 798 3288)
Lehre
Die Lehrtätigkeit der Universitätsklinik für Neurochirurgie umfasst das gesamte Spektrum neurochirurgischer Krankheitsbilder von Diagnostik bis zur Therapie. Neben Vorlesungen gehören Patient*innenkollegs, Problemlösevorlesungen sowie fachspezifische Konsultationen zum Portfolio des Lehrangebots. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen liegt ein Schwerpunkt auf der Lehre von klinisch-praktischen Fertigkeiten im Rahmen eines Untersuchungskurs Rücken und eines Operationspraktikums.
Weiter sind Abschlussarbeiten (wie z.B. Masterarbeiten, Doktorarbeiten) und Forschungsarbeiten (z.B. im Rahmen des Longitudinalen Forschungskurikulums im Humanmedizinstudium) im Bereich der klinischen als auch Grundlagenforschung Teil unseres Lehrangebots. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.